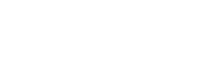Altarbild: Maria Magdalena
Das Altarbild stellt die Kirchenpatronin Maria Magdalena dar.
Schon früh verschmolzen drei verschiedene Frauengestalten zu einer einzigen Person: Maria Magdalena. Dabei ist „Magdalena“ nicht eigentlich ein Name, sondern eine Herkunftsbezeichnung und bezieht sich auf das Dorf Magdala (Migdal) am See von Genezareth. Liturgie, Legenden, Volksfrömmigkeit und die Kunst setzten Maria aus Magdalena, jene Frau, die durch Christus von schwerer dämonischer Besessenheit geheilt wurde (Lk 8,2), mit Maria aus Bethanien, der Schwester von Lazarus und Martha (Joh 11,1-2), und der öffentlichen "Sünderin" (Dirne), welche Jesus die Füße wusch und salbte (Lk 7,36-50), gleich.
Die erstgenannte Maria Magdalena gehörte nach der Heilung zu den Frauen, die Jesus unterstützten und ihn begleiteten. Sie ging seinen Leidensweg mit und stand unter dem Kreuz bis zum späten Abend, als Joseph von Arimatäa der Leichnam Christi vom Kreuz nehmen ließ. Am Ostermorgen war sie mit den Frauen beim Grab. Sie begegnete dem Auferstandenen, der sie mit ihrem Namen rief, und beauftragte sie, den Jüngern die Auferstehung kundzumachen (Joh 20,1-10).
Nach der Legenda aurea, einem bekannten und weit verbreiteten religiösen Volksbuch des 13. Jahrhunderts, lebte Maria Magdalena 30 Jahre lang unerkannt in rauer Wildnis. Jeden Tag wurde sie zu den sieben Gebetszeiten von Engeln in die Lüfte gehoben und hörte den Gesang der himmlischen Heerscharen.
Infolge der Kombination aus drei verschiedenen Personen wird Maria Magdalena mit einem Salbgefäß, unter dem Kreuz und in einer Höhle mit aufgelöstem Haar, das sie wie ein Mantel umgibt (antikes Kennzeichen einer Prostituierten), oder nur mit einem Fell bekleidet, dargestellt. Manchmal wird ihr statt der Salbendose auch ein Kruzifix und ein Totenkopf beigegeben. Einige Darstellungen zeigen die Heilige auch mit Engeln, die sie in der Legende nach den Himmel tragen (Quelle: Das große Hausbuch der Heiligen. Hrsg. von Diethard H. Klein. München: Pattloch 2000).
Das Altarbild der Leithaprodersdorfer Kirche greift auf diese traditionellen Motive zurück: Maria wird mit offenem aufgelöstem Haar dargestellt, wie sie vor dem Kruzifix kniet und einen Totenschädel in Händen hält. Engel schweben um sie herum und heben sie in den Himmel.
Das Altarbild wurde im Jahr 1807 von Franz Ignaz Maurer, einem Ödenburger Maler, geschaffen, und 2006 von Mag. Ditta Tomaszewski restauriert. Es befindet sich auf dem barocken Hochalter, der aus dem 18. Jahrhundert stammt und im 19. Jahrhundert verändert wurde. Das Bild wird - vom Betrachter aus links - von der Statue des hl. Stephanus von rechts vom hl. Antonius von Padua begrenzt.
Weingartenmadonna

Die "Weingartenmadonna" steht beim Mitteleingang und begrüßt die Gläubigen beim Eintritt in das Kirchenschiff. Sie stellt Maria stehend im Typus einer "Madonna" als Mutter dar, die das Kind auf ihren Armen trägt. Die 1,20 m hohe Statue ist aus dunklem Lindenholz gefertigt und wurde 1977 um S 27.000,-- vom Weinbauverein unter dem damaligen Obmann Georg Alfons aus dem Erlös der jährlichen Weinkost angeschafft. Die Segnung erfolgte am 7.10.1977 unter Pfarrer Johann Ecker. Bis zur Kirchenrenovierung 2001 war diese Madonna im Altarraum hinter der Sessio (Priestersitz) platziert.
Als Marien- oder Madonnenbildnis bezeichnet man in der christlichen Ikonographie die Darstellung Marias allein oder gemeinsam mit dem Jesuskind. Der populäre Begriff "Madonna" wird überwiegend für Einzeldarstellungen der Gottesmutter mit ihrem Kind verwendet. Seit dem 3. Jahrhundert bildet das Marienbild den häufigsten Gegenstand der christlichen Kunst, der sich auf zahllosen Bildmedien und in vielfachen inhaltlichen Zusammenhängen präsentiert und der Marienverehrung bildhaften Ausdruck verleiht.
Vom Kreuz herab hat der Herr Seine Mutter auch uns zur Mutter gegeben. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für das pilgernde Gottesvolk und wird daher zu Recht als Fürsprecherin, Helferin, Beistand und Mittlerin angerufen (vgl. II. Vatikanische Konzil, Lumen Gentium 62). Seit frühesten Zeiten hat das christliche Volk deshalb Maria besonders verehrt.
Erzmärtyrer Stephanus

Vom Betrachter aus links gesehen, befindet sich auf dem Hochalter die vergoldete Statue des hl. Stephanus, des ersten Märtyrers. Sein Fest wird am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtstag, gefeiert. Die Statue erinnert wohl daran, dass die frühere Pfarrkirche am Berg diesem Heiligen geweiht war und Leithaprodersdorf daher als "Stephanspfarre" galt.
Von ihm erzählt die Apostelgeschichte in den Kapiteln 6 und 7. Dort wird der Stephanus als einer der ersten sieben Diakone genannt und als ein Mann voll Gnade und Kraft beschrieben, der Wunder wirkte und Zeichen unter dem Volk setzte. Weil er das Evangelium mit Freimut verkündigte, wurde er beschuldigt, Gott zu lästern, und vor den Hohen Rat gebracht. Dieser verurteilte ihn zum Tod durch Steinigung. Im Sterben sah Stephanus den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Sterbend verzieh er seinen Mördern.
Auf der Statute ist Stephanus als junger Mann, bekleidet mit der Dalmatik (den Gewändern eines Diakons), dargestellt. In der Hand hält er das Evangelienbuch, auf dem einige Steine liegen, mit denen er zu Tode gebracht wurde. Bei uns fehlt der Palmzweig in der Hand (Symbol für einen Märtyrer), der bei anderen Darstellungen häufig erscheint.